Konfliktstufen nach Glasl erkennen: Praxiswissen für Führungskräfte
Wenn ein kleiner Funke einen Großbrand entfacht
In einem meiner letzten Workshops schilderte eine Teilnehmerin, wie ein zunächst harmloser Konflikt zwischen zwei Mitarbeitenden nach kurzer Zeit das gesamte Team lähmte. Warnsignale wie eine plötzliche Zurückhaltung in der Kommunikation oder ungewohnte Spannungen während der Teammeetings wurden übersehen – und die Situation eskalierte immer weiter.
Solche Situationen sind keine Seltenheit. Gerade deshalb ist es entscheidend, Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu verstehen, wie sie sich entwickeln können. Das Modell der Konfliktstufen nach Friedrich Glasl bietet Führungskräften genau hierfür eine praxiserprobte Orientierung.
Doch bevor wir in die Theorie eintauchen, möchte ich Ihnen ein warnendes Beispiel aus meiner Beratungspraxis erzählen. Es zeigt eindrucksvoll, was passiert, wenn man die Stufen ignoriert.
Praxis-Fallstudie: „Hauptsache, die andere muss auch gehen“
Ich wurde zu einem Fall gerufen, bei dem der Konflikt bereits weit fortgeschritten war. Es ging um zwei Assistentinnen, die gemeinsam für mehrere Geschäftsführer*innen arbeiteten.
Die Situation: Was als normale Reiberei begann, hatte sich zu einem Grabenkrieg entwickelt.
- Koalitionen statt Dialog: Jede der beiden versuchte aktiv, Mitarbeitende und Führungskräfte mit „ins Boot“ zu holen und sich zu solidarisieren, um zu beweisen, wie unfähig die jeweils andere sei.
- Öffentliche Demütigung: Die Eskalation zeigte sich in zynischen Symbolen. Eine Assistentin hängte demonstrativ ein Bild mit dem Titel „Dies wird ein schlechter Tag“ an ihren Platz, sobald die Kollegin aus dem Urlaub zurückkam.
- Führungs-Vakuum: Die zuständigen Geschäftsführer wollten sich „nicht einmischen“ und hofften auf Selbstregulierung. Ein fataler Fehler.
Das Ergebnis: Als ich um ein Coaching bzw. eine Mediation gebeten wurde, war das Tischtuch längst zerschnitten. Es gab keine Bereitschaft mehr, aufeinander zuzugehen. Der Satz, der fiel, war erschreckend und typisch für die höchste Eskalationsstufe: „Es ist mir egal, wenn ich gehen muss – Hauptsache, die andere muss auch gehen.“
Hier ging es nicht mehr um Lösungen, sondern um die Vernichtung des Gegners, selbst um den Preis der eigenen Nachteile (Stufe 9: Gemeinsam in den Abgrund). Die Geschäftsführung musste am Ende beide Mitarbeiterinnen entlassen. Ein massiver Verlust von Know-how und ein Schaden für das Betriebsklima, der durch früheres Eingreifen verhinderbar gewesen wäre.
Das Modell verstehen: Die 9 Konfliktstufen nach Glasl
Friedrich Glasl, ein österreichischer Konfliktforscher, beschreibt neun Stufen, die in drei Hauptphasen unterteilt sind. Diese Einteilung hilft Ihnen sofort zu erkennen: Ist das noch gesund oder schon gefährlich?
Phase 1: Win-Win (Hier ist noch Selbsthilfe möglich)
In dieser Phase geht es noch um die Sache. Beide Parteien wollen eine Lösung und glauben, dass beide davon profitieren können.
- Stufe 1: Verhärtung – Standpunkte prallen aufeinander, erste Spannungen, aber noch Gesprächsbereitschaft.
- Stufe 2: Polarisierung & Debatte – Schwarz-Weiß-Denken beginnt. Man will den anderen intellektuell überzeugen, wird dabei aber emotionaler.
- Stufe 3: Taten statt Worte – Reden hilft scheinbar nicht mehr. Man stellt den anderen vor vollendete Tatsachen. Das Misstrauen wächst.
Phase 2: Win-Lose (Hier braucht es Hilfe von außen)
Der Respekt schwindet. Einer kann nur gewinnen, wenn der andere verliert. Moralische Hemmungen fallen.
- Stufe 4: Images & Koalitionen – „Wer nicht für mich ist, ist gegen mich.“ Man sucht Verbündete und redet überden anderen statt mit ihm (siehe das Assistentinnen-Beispiel).
- Stufe 5: Gesichtsverlust – Öffentliche Angriffe. Ziel ist es, den anderen bloßzustellen oder moralisch zu diskreditieren (z.B. das Bild „Dies wird ein schlechter Tag“).
- Stufe 6: Drohstrategien – Man will die Kontrolle erzwingen. „Wenn du nicht X machst, dann mache ich Y.“ Das Stresslevel ist extrem hoch.
Phase 3: Lose-Lose (Der „Point of No Return“)
Hier gibt es keine Gewinner mehr. Es geht nur noch darum, dem anderen mehr zu schaden als sich selbst.
- Stufe 7: Begrenzte Vernichtungsschläge – Man nimmt kleinen eigenen Schaden in Kauf, solange es den anderen härter trifft.
- Stufe 8: Zersplitterung – Das System des Gegners soll zerstört werden.
- Stufe 9: Gemeinsam in den Abgrund – Totale Konfrontation. Die eigene Vernichtung wird in Kauf genommen, solange der Feind mit untergeht.

Der Wendepunkt: Wann können Konfliktpartner das noch selbst lösen?
Eine der wichtigsten Fragen für Führungskräfte ist: Muss ich schon eingreifen oder regeln die das allein? Glasl gibt hier eine klare Orientierung.
Selbsthilfe möglich (Stufe 1–3)
Solange der Konflikt in Phase 1 (Win-Win) ist, können die Beteiligten den Konflikt oft noch selbstständig oder mit leichter moderativer Unterstützung durch die Führungskraft lösen.
- Kennzeichen: Man hört einander noch zu. Es geht primär um die Sache, nicht um die Person.
- Ihre Aufgabe: Ermutigen Sie zum Gespräch, bieten Sie einen Raum dafür an, aber lassen Sie die Verantwortung bei den Mitarbeitenden.
Externe Hilfe nötig (Stufe 4–6)
Ab Phase 2 (Win-Lose) ist Selbsthilfe fast unmöglich. Die Wahrnehmung der Realität ist verzerrt („Ich bin gut, du bist böse“).
- Kennzeichen: Es wird übereinander gelästert, Parteien gebildet, die Sachebene wurde verlassen.
- Ihre Aufgabe: Hier müssen Sie eingreifen. Ein einfaches „Klärt das mal unter euch“ (wie im Fall der Assistentinnen) führt hier nur zur weiteren Eskalation. Sie brauchen professionelle Hilfe: Sei es durch Ihre klare Führung, einen internen Mediator oder einen externen Coach/Berater.
Machtwort oder Trennung (Stufe 7–9)
In Phase 3 (Lose-Lose) hilft meist keine klassische Mediation mehr, da der Wille zur konstruktiven Einigung fehlt.
- Kennzeichen: Destruktives Handeln, Schädigungsabsicht.
- Ihre Aufgabe: Hier hilft oft nur noch ein Machteingriff (Versetzung, Abmahnung) oder die Trennung, wie im oben genannten Beispiel. Eine therapeutische Aufarbeitung ist oft notwendig.
Warum Eskalation oft übersehen wird
In meiner Arbeit beobachte ich häufig, dass Führungskräfte erste Konfliktanzeichen nicht ernst genug nehmen. Gründe dafür können sein:
- Mangelndes Bewusstsein für subtile Signale
- Angst, Probleme offen anzusprechen
- Die Hoffnung, der Konflikt werde sich von selbst lösen (ein fataler Irrtum ab Stufe 3!)
- Zeitdruck und Prioritätenverschiebung
- Fehlendes Know-how im Umgang mit zwischenmenschlichen Spannungen
Dabei sind es oft kleine Gesten, unausgesprochene Spannungen oder Ironie in der Kommunikation, die auf eine beginnende Eskalation hinweisen. Wer lernt, diese Anzeichen zu deuten, kann rechtzeitig gegensteuern, bevor der Konflikt das Teamklima dauerhaft belastet.
Praktische Tipps für Führungskräfte
- Hinschauen statt Wegschauen: Warten Sie nicht, bis das „Dies wird ein schlechter Tag“-Schild hängt. Reagieren Sie schon bei Stufe 2 oder 3 (Polarisierung/Taten statt Worte).
- Regelmäßige Einzelgespräche: Fragen Sie nicht nur nach Projekten, sondern auch: „Wie läuft die Zusammenarbeit mit XYZ?“
- Die „Büro-Thermometer“-Frage: Nutzen Sie Teambesprechungen für kurze Reflexionen: „Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie viel Energie verlieren wir gerade durch interne Reibereien?“
- Holen Sie sich Hilfe: Es ist kein Zeichen von Schwäche, bei Stufe 4 oder 5 einen externen Experten hinzuzuziehen. Es ist ein Zeichen von Professionalität und Wirtschaftlichkeit.
Konfliktstufen kompakt auf einen Blick
Viele Führungskräfte, die ich begleite, wünschen sich ein einfaches, praxisnahes Werkzeug, um sich im Konfliktfall schnell zu orientieren: Was sehe ich gerade? Was ist jetzt noch möglich? Wann brauche ich Unterstützung von außen?
Genau dafür habe ich eine kompakte Übersichtstabelle zu den Konfliktstufen nach Glasl erstellt – mit typischen Anzeichen je Stufe, passenden Handlungsmöglichkeiten und einer Einschätzung zur Interventionsfähigkeit.
Hier können Sie die Tabelle kostenlos als PDF herunterladen:
🔗 Download: Konfliktstufen nach Glasl – Übersicht für Führungskräfte
Nutzen Sie diese Übersicht z. B. zur Vorbereitung auf schwierige Gespräche, zur Teamdiagnose oder zur Selbstreflexion – ein bewährtes Instrument aus meiner Coaching-Praxis.
Der Blick in den Spiegel: Wenn Sie selbst im Konflikt stecken
Das Modell von Glasl hilft uns hervorragend, Konflikte bei anderen zu analysieren. Aber Hand aufs Herz: Wir sind als Führungskräfte nicht immun. Auch wir geraten in Konflikte, fühlen uns angegriffen oder unverstanden. Wie merken Sie selbst, dass Sie auf der Eskalationsleiter gerade nach unten klettern – und wie kommen Sie da wieder raus?
Der Selbst-Check: Bin ich schon auf Stufe 4?
Ein sehr zuverlässiges Warnsignal ist Ihr innerer Monolog.
- Stufe 1–3 (Noch gesund): Sie denken: „Das Verhalten von Herrn Müller in dem Meeting heute hat mich geärgert. Ich muss das morgen ansprechen.“ (Fokus auf Verhalten/Sache).
- Ab Stufe 4 (Gefährlich): Sie denken: „Herr Müller ist einfach inkompetent. Typisch, dass er mir wieder in den Rücken fällt. Der ändert sich nie.“
Sobald Sie anfangen, nicht mehr über das konkrete Verhalten, sondern über den Charakter des anderen zu urteilen („Der ist so“), haben Sie die Ebene der Kooperation verlassen. Sie bauen ein Feindbild auf.
Ausweg durch den Realitäts-Check (Exkurs: „The Work“)
Wenn Sie merken, dass Sie sich in solchen Gedankenschleifen verfangen, lohnt sich ein kurzer Exkurs zu einer Methode, die als „The Work“ von Byron Katie bekannt ist. Sie ist radikal, aber im Business-Kontext extrem wirkungsvoll, um die eigene Wahrnehmung zu überprüfen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben den Gedanken: „Meine Kollegin respektiert mich nicht.“ Dieser Gedanke führt zu Wut, Rückzug oder Gegenangriff (Eskalation).
Bevor Sie handeln, stellen Sie sich vier Fragen:
- Ist das wahr? (Habe ich Beweise? Oder ist es eine Interpretation?)
- Kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? (Könnte sie vielleicht einfach gestresst sein? Hat sie es wirklich so gemeint?)
- Wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken glaube? (Ich werde zynisch, ich gehe ihr aus dem Weg, ich rede schlecht über sie -> Ich trage zur Eskalation bei).
- Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? (Ich wäre gelassener, könnte offen auf sie zugehen und fragen: „War das vorhin Kritik oder nur ein Hinweis?“)
Die Umkehrung (Der Spiegel):
Versuchen Sie den Gedanken einmal umzudrehen, um Ihren eigenen Anteil zu erkennen:
- „Ich respektiere mich selbst nicht“ (weil ich meine Grenzen nicht klar aufzeige).
- „Ich respektiere meine Kollegin nicht“ (weil ich ihr gerade böse Absichten unterstelle, ohne zu fragen).
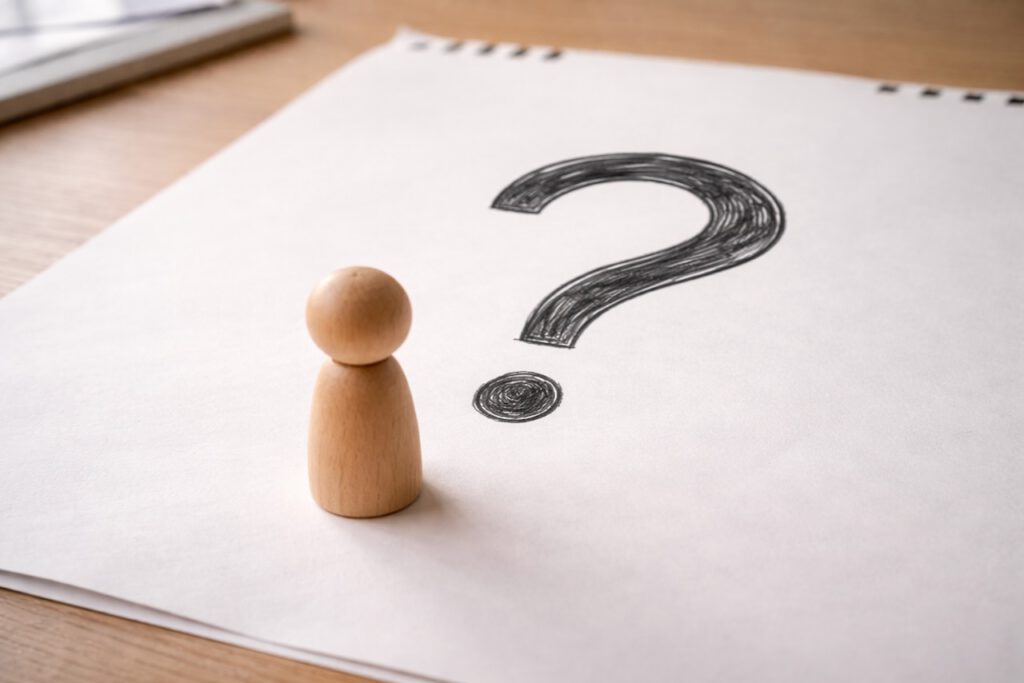
Der erste Schritt zurück
Erkenntnis ist der erste Schritt zur Deeskalation. Wenn Sie erkennen, dass Ihr Ärger oft mehr mit Ihrer Interpretation der Situation zu tun hat als mit den Fakten, gewinnen Sie Handlungsspielraum zurück.
Wie gehe ich auf den Konfliktpartner zu?
Wenn Sie den Konflikt lösen wollen, müssen Sie die „Kampf-Arena“ verlassen. Ein guter Einstiegssatz, der oft Wunder wirkt und die Stufen 1–3 wiederherstellt, lautet:
„Ich habe gemerkt, dass sich bei mir in letzter Zeit Ärger angestaut hat und ich dir gegenüber innerlich auf Distanz gegangen bin. Das möchte ich nicht, weil ich unsere Zusammenarbeit schätze. Können wir uns zusammensetzen und klären, was da zwischen uns steht?“
Damit übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gefühle (Ich-Botschaft), ohne den anderen anzuklagen. Das ist Führungskunst in eigener Sache.
Fazit
Konfliktfähigkeit ist keine „weiche“ Kompetenz, sondern harter Wirtschaftsfaktor. Der Fall der beiden Assistentinnen zeigt: Wer zu lange wegschaut, zahlt am Ende den höchsten Preis – den Verlust wertvoller Mitarbeitender.
Nutzen Sie das Modell von Glasl nicht nur als Theorie, sondern als Radar. Wenn Sie merken, dass es nicht mehr um die Sache geht (Stufe 4), greifen Sie ein. Sofort.
